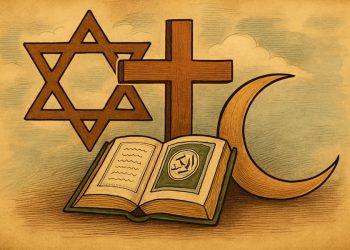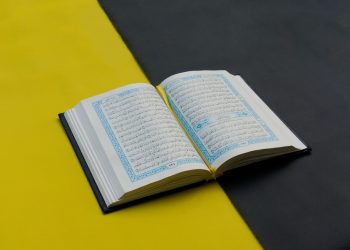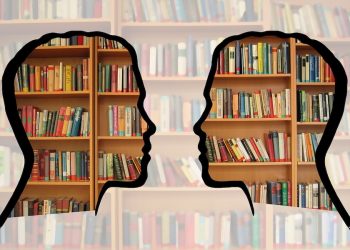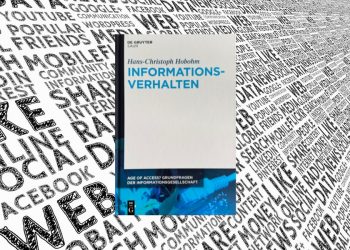Neulich habe ich im Maximilianpark in Hamm eine interessante Kunstausstellung besucht. Drei Fotojournalisten der Lokalzeitung Westfälischer Anzeiger haben ihr über Jahre hinweg gesammeltes visuelles Gedächtnis zusammengetragen. Die Bilder trugen nicht nur die Gesichter der Vergangenheit, sondern auch den Geist der Stadt in die Gegenwart. Stillgelegte Zechen, einst glanzvolle Kaufhäuser – die Schilder von Horten und Kaufhof – und die Besuche von Politikerinnen und Politikern wie Angela Merkel und Cem Özdemir, die heute nur noch in den Erinnerungen leben.
Doch das eigentlich Erschütternde war ein hölzerner Sarg in der Mitte eines Raumes, dessen drei Wände mit Fotografien bedeckt waren. Im offenen Sarg lagen übereinandergestapelte Zeitungen und ein Buch, am Kopfende zwei Smartphones… Kein Kommentar nötig: Die Zeitungen symbolisierten den schwerfälligen Nachrichtenfluss der Vergangenheit; die Smartphones die schnelle, schwindelerregende Aktualität von heute. Und das Buch schaute uns mitten in all diesem Trubel in stiller Einsamkeit an.
Angesichts dieser Szene drängten sich mir unwillkürlich Erinnerungen an meine Erfahrungen im Klassenzimmer auf. Am Ende des vergangenen Schuljahres hatte ich im Türkischunterricht die Schülerinnen und Schüler aus der 7. Klasse gebeten, in den Ferien unbedingt ein Buch zu lesen. Jede und jeder sollte das Gelesene anschließend vorstellen, was auch benotet werden sollte. Doch in der ersten Stunde des neuen Schuljahres stand von zweiundzwanzig Kindern nur eines vor mir mit einem Buch in der Hand, und das war lediglich eine kurze Erzählung von einem renommierten Literaten. Sollte mich das erstaunen? Vielleicht nicht. Denn wir wissen längst, dass die Lust der Heranwachsenden am Lesen dramatisch schwindet, während die sozialen Medien, vor allem TikTok, deren Leben fast vollständig umzingeln.
Der Sarg in der Ausstellung erschien mir wie das Sinnbild einer Totenfeier für die Gutenberg-Revolution. Für den Tod der Druckerpresse, der Zeitung, des Buches… Auch die digitalen Geräte, die an ihre Stelle getreten sind, werden in ihrer Durchsetzung tiefe Schatten hinterlassen. Das Smartphone ist längst so selbstverständlich geworden wie Brot und Wasser. Seine Vorteile sind unumstritten. Doch wenn es nicht maßvoll und klug genutzt wird, bergen die Inhalte die Gefahr von Sucht und sozialen wie psychischen Problemen. Bringen uns die unaufhörlich aktualisierten Bildschirme tatsächlich bessere, gesündere Informationen? Oder ist es vielmehr ein atemloser Strom, der unsere Aufmerksamkeit zerreißt, uns durch die im Belohnungszentrum im Gehirn erzeugte Abhängigkeit versklavt, unsere Sprache verarmen lässt und unsere geistige Welt ins Chaos stürzt? All das macht es notwendig, bei jungen Menschen das digitale Bewusstsein und die Medienresilienz zu stärken.
Zahlreiche Studien haben bereits die schädlichen Folgen eines gedankenlosen Umgangs mit digitaler Medienwelt aufgezeigt. Viele Schüler verziehen heute schon das Gesicht, wenn sie nur das Wort „lesen“ hören; als gerate ihr inneres Gleichgewicht ins Wanken. Im Zuge der Digitalisierung entfernen sich die Jugendlichen immer schneller nicht nur vom gedruckten Buch, sondern auch vom Lesen selbst. Dass Smartphones und Tablets dessen Platz jemals ausfüllen könnten, ist mehr als fraglich. Die negativen Folgen, die soziale Medien und künstliche Intelligenz neurologisch, psychisch, sozial und kognitiv schlagen, sind laut Forschung von beachtlicher Tiefe. Verschwinden tut dabei nicht nur das Bemühen, nützliches Wissen zu sammeln, sondern auch der geistige Einsatz, um etwas über das Leben zu lernen. Noch bedenklicher ist jedoch dies: Mit ihrer Entscheidung zwischen der mühelosen Lust eines TikTok-Videos und der Anstrengung, die ein Buch verlangt, treiben viele Schüler unbewusst ihr eigenes Sprachvermögen und ihren Geist in einen stillen Selbstmord.
Am stärksten leidet darunter die Sprache. Die hastig vorbeiziehenden Bilderfluten der sozialen Medien, durchsetzt mit bruchstückhaften und verzerrten Informationen, nähren das Denken nicht. Viele junge Menschen, die ohnehin mit Identitätsfragen ringen, nehmen dort zudem jede ideologische oder religiöse Botschaft unkritisch auf. Das aber führt zur Verarmung nicht nur der Sprache, sondern auch des Gedächtnisses.
In solch einem Prozess fällt die erste Verantwortung den Eltern zu. Denn die Sprache wächst in der Regel zunächst in der Familie, und erst später in der Schule. Die Liebe zum Buch gehört zu den größten Vermächtnissen, die man einem Kind mitgeben kann. Bücher lassen die Sprache wachsen, Sprache lässt das Denken reifen, Denken lässt die Reife gedeihen – psychisch wie sozial. Die meisten sozialpsychologischen Probleme, die wir heute bei Jugendlichen beobachten, sind auf das Fehlen dieses Prozesses zurückzuführen.
Nach der Familie liegt die größte Verantwortung beim Bildungssystem. Dass in Deutschland 15 bis 20 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler nicht über angemessene Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen, zeigt uns nicht nur ein pädagogisches Defizit, sondern auch ein zentrales psychosoziales Problem unserer Zeit. In einer Epoche, in der Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Gesellschaften tiefgreifend verändern, stellt sich die Frage: Wie bewahren wir jene Denk- und Sprachfähigkeit, die den Menschen zum Menschen macht und ihn zu Mündigkeit wie zu ethischer Reife führt?
Vielleicht ist es in Wahrheit nicht nur die gedruckte Zeitung und das Buch, die in jenen Sarg gelegt wurden, sondern unsere Denkfähigkeit, unsere Sprache. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird nach der Druckerpresse – und keine drei Generationen später – auch ihre Beerdigung unvermeidlich sein.
In unserer Zeit, in der alles durch Augen und Sichtbarkeit nach außen gelesen – vielleicht nur flüchtig angeschaut – wird, kann man sagen, dass unsere innere Welt und der Boden, der das Leben trägt, zu bröckeln begonnen haben. Wie ein türkischer Dichter sagte:
Von meinem zerfall’nen Palast ist die Zier längst entflohn;
Die Augen genagelt nach außen, der Blick nach innen entflohn. (NFK)