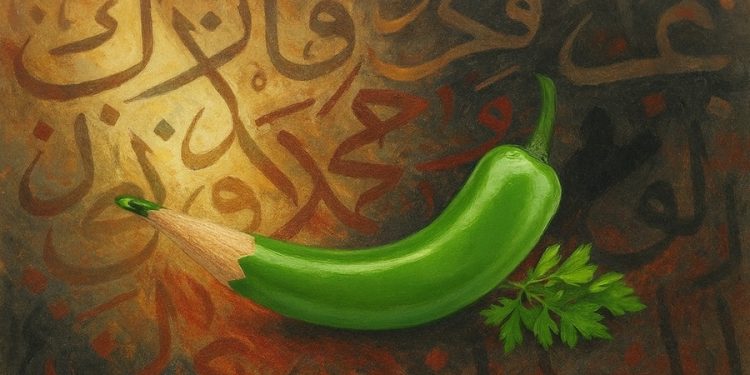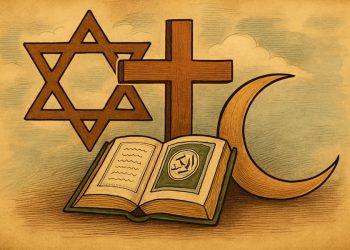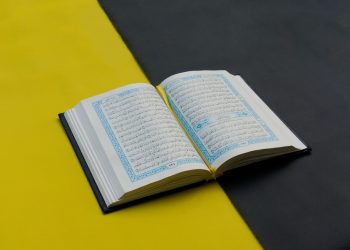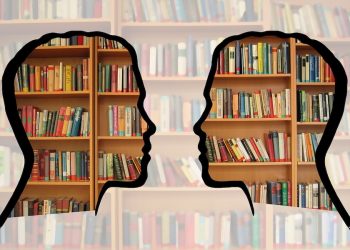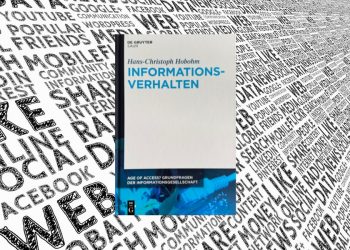Sprache befindet sich in einem ständigen Wandel. Dieser Wandel zeigt sich nicht nur in der Ableitung neuer Wörter, sondern auch in der allmählichen Veränderung oder Umformung bereits bestehender Bedeutungen.
In der Linguistik werden Bedeutungsverschiebungen oder -veränderungen gewöhnlich unter vier Hauptkategorien zusammengefasst:
Bedeutungsweitung: Ein Wort erhält im Laufe der Zeit eine weiter gefasste Bedeutung und umfasst mehr Gegenstände oder Sachverhalte. So bedeutete das türkische Wort baş (Kopf) ursprünglich nur den „Kopf des Menschen“, wurde aber später auch im Sinne von „Spitze, Anführer, Vorderseite“ verwendet.
Bedeutungsverengung: Ein Wort, das einst allgemeinere Bezüge hatte, erfährt im Laufe der Zeit eine Einschränkung auf eine speziellere Bedeutung. Das türkische Wort et bedeutete im Alttürkischen allgemein „Speise“, bezeichnet heute aber nur noch „Fleisch“ (von Tieren).
Bedeutungsverschiebung: Ein ursprünglich negativ konnotiertes Wort erhält mit der Zeit eine positive Bedeutung. So bedeutete yavuz früher „schlecht, elend, verderbt“, wurde aber später im Sinne von „tapfer, heldenhaft, tüchtig“ gebraucht.
Bedeutungsübertragung: Das türkische Wort dil (Zunge) wird nicht nur für das Körperorgan, sondern auch im übertragenen Sinn für „Sprache“ gebraucht.
Diese Einteilung, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Linguisten entwickelt wurde, unterscheidet die historische Entwicklung vieler Wörter. Oft spiegeln selbst geringfügige Bedeutungsänderungen die Veränderungen im Denken und in der Weltsicht einer Gesellschaft wider. Doch solche Bedeutungsumdeutungen hängen nicht nur mit der inneren Entwicklung einer Sprache zusammen, sondern auch mit den historischen Erfahrungen der jeweiligen Gemeinschaften.
In diesem Zusammenhang soll im Folgenden kurz analysiert werden, warum bestimmte Wörter und Ausdrücke im Koran im Laufe der Geschichte Bedeutungsveränderungen erfahren haben.
Betrachtet man die islamische Geschichte, lässt sich feststellen, dass es sich hierbei um einen über Jahrhunderte hinweg verlaufenden soziopolitischen Prozess handelt, in dem sich Glaubensvorstellungen unter dem Einfluss unterschiedlicher Strömungen, Rechtschulen und politischer Autoritäten herausbildeten. Eine semantisch fundierte Untersuchung dieser Prozesse könnte im Bereich der Religionspädagogik neue Horizonte eröffnen.
Bedeutungsmanipulation?
Im Allgemeinen treten Religionen u.a. mit dem Anspruch auf, Tugend, Wahrhaftigkeit und die Unterscheidung von Gut und Böse zu lehren. Von den Gläubigen wird erwartet, dass sie diesen Prinzipien folgen. Historisch gesehen sind Religionen jedoch zugleich die Bereiche, in denen Manipulationen und Instrumentalisierungen besonders häufig vorkommen. Denn ihre enorme Fähigkeit, Menschen und Gemeinschaften zu mobilisieren, ist unbestreitbar.
Daher entstehen bestimmte Bedeutungsveränderungen in religiösen Texten nicht als Teil natürlicher Sprachentwicklung, sondern häufig durch bewusste Eingriffe und Manipulationen.
Solche Umdeutungen finden sich besonders oft in den Koranexegesen (Tafsīr). Bei näherer Betrachtung wird deutlich, wie vielen Begriffen neue Bedeutungen zugeschrieben wurden, die mit ihrem ursprünglichen historischen Kontext wenig zu tun haben. Diese Art gezielter Bedeutungsverschiebung, die über die vier natürlichen linguistischen Prozesse hinausgeht, kann als „anachronistische Bedeutungsaufladung“ bezeichnet werden. Anhand einiger Beispiele lässt sich dieser Begriff besser erläutern.
Zwei zentrale Ursachen
Warum wurden im Laufe der islamischen Geschichte – insbesondere in Übersetzungen und Koranauslegungen – vielen Begriffen geänderte Bedeutungen aufgezwungen? Zwei Hauptgründe sind hierfür ausschlaggebend:
1) Die Zuschreibung besonderer „Bedeutsamkeit“
Der deutsche BegriffBedeutsamkeitist hier besonders aufschlussreich, da er sowohl „Bedeutung“ als auch „Wichtigkeit“ umfasst. Heiligen Texten oder Begriffen wird eine zusätzliche Dimension des „Sinns“ und der „Gewichtigkeit“ verliehen. Das Wort gewinnt durch die Autorität seines Urhebers an Gewicht. Diese Haltung bildet eine zentrale Motivation für viele anachronistische Bedeutungsaufladungen. So wird in jeder Silbe des Korans – oft mit erheblichem interpretatorischem Aufwand – eine göttliche Weisheit gesucht. Da Gott als allwissend gilt, glaubt man, alle wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnisse der Menschheitsgeschichte seien bereits im Koran verborgen enthalten.
Einige vertreten die Auffassung, der Koran könne nicht durch den begrenzten Sprachhorizont der Araber erfasst werden und enthalte „unendlich viele Bedeutungsebenen“. Dennoch wenden sie diese Methode nicht konsequent an: Während sie behaupten, der Koran spreche universell jenseits der arabischen Kultur, interpretieren sie Paradies- und Höllenvorstellungen dennoch im Rahmen der sinnlichen Vorstellungswelt der arabischen Wüste.
2) Politische und ideologische Einflussnahme
Die Tafsīr-Tradition, die nach der Sammlung des Korans einsetzte, war nie völlig neutral oder ausschließlich religiös motiviert. Vielmehr spiegeln die Exegesen stets auch die politischen, konfessionellen und gesellschaftlichen Umstände ihrer Zeit wider. Wie Menschen selbst tragen auch ihre Werke den „Farbton ihrer Epoche“.
Insbesondere die Umayyaden und Abbasiden förderten bestimmte Interpretationsrichtungen, um ihre politische Herrschaft zu legitimieren. Angesichts der Tatsache, dass unter den Umayyaden zehntausende erfundene Hadithe kursierten, erscheint es naiv anzunehmen, dass ihre Autorität die Koranexegese unberührt ließ.
Zwar ist die Tafsīr-Literatur grundsätzlich Ausdruck des Bemühens, den Koran zu verstehen, doch dieses Bemühen blieb nie völlig unabhängig von theologischen Präferenzen, politischer Einflussnahme oder den soziohistorischen Bedingungen der jeweiligen Zeit.
So unterstützten politische Machthaber Auslegungen, die Ordnung und Einheit betonten – etwa die Lehre des Imām al-Ašʿarī mit ihrem Appell, „nicht von der Gemeinschaft abzuweichen“. Auch Gemeinschaften, die sich theoretisch auf die rational orientierte Māturīdī-Tradition beriefen, handelten in der Praxis häufig ašʿaritisch, wenn kollektive Geschlossenheit im Vordergrund stand.
Auf diese Weise wurde der Koran zeitweise zu einem Instrument, das autoritäre und hierarchische Herrschaftsformen stützte. Die bis heute nachwirkende Kultur von „Gehorsam und Unterwerfung“ wurzelt nicht selten in solchen historisch geprägten und anachronistischen Auslegungen.
Manipulative Bedeutungsverschiebungen, die unter dem Einfluss ideologischer oder politischer Interessen entstanden, gehören bis heute zu den größten Problemen religiöser Bildung. Das in den Köpfen vieler Muslime vorherrschende Bild von Religion und Islam basiert in hohem Maße auf Begriffen, deren Bedeutungen im Lauf der Geschichte verändert oder verfälscht wurden.
Vier Hauptmethoden mit Beispielen
In den Exegesen treten im Wesentlichen vier Methoden solcher Bedeutungsverschiebungen und anachronistischen Bedeutungsaufladungen auf:
1) Bedeutungsmanipulationen des Korans zugunsten politischer oder gemeinschaftsbezogener Interessen
Das Wort „ümmī“ wird in den klassischen Quellen im Sinne von „eine Gemeinschaft, der keine Offenbarung zuteilgeworden ist und die nach ihrer eigenen Überlieferung lebt“ verwendet (aṭ-Ṭabarī, Ǧāmiʿ al-Bayān; az-Zaǧǧāǧ, Maʿānī al-Qurʾān). Für den Propheten Muhammad bedeutet die Bezeichnung ümmī in diesem Zusammenhang „nicht zu den Schriftbesitzern gehörig“. In den folgenden Jahrhunderten wurde der Begriff jedoch – vor allem, um den wundersamen Charakter des Prophetentums hervorzuheben – im Sinne von „des Lesens und Schreibens unkundig“ interpretiert und so zu einem Beweis der Prophetie umgedeutet (Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, Mafātīḥ al-Ġayb). Damit erhielt das Wort ümmī außerhalb seines ursprünglichen historischen Zusammenhangs eine neue, ideologisch motivierte Bedeutung.
Das Wort „fitna“ wird im Koran in der Frühzeit im Sinn von „Prüfung, Erprobung, Bewährung“ verwendet (al-Baqara 2:193; al-Anfāl 8:28). Nach den klassischen Lexika bedeutet fitna ursprünglich „das Läutern von Gold im Feuer“ (Ibn Fāris, Maqāyīs al-luġa). Nach den frühen innerislamischen Bürgerkriegen – insbesondere nach der Schlacht von Dschamal und Siffīn – erhielt der Begriff jedoch eine politische Konnotation und wurde im Sinne von „Aufruhr, Rebellion“ gebraucht, um jede Form von Opposition gegen die bestehende Autorität als illegitim erscheinen zu lassen (Ibn Kaṯīr, Tafsīr). In religiösen Gemeinschaften der Gegenwart wird nahezu jede Form von Kritik als „fitna“ (Unruhe-Stiftung) gebrandmarkt und damit unterdrückt. Ein ursprünglich neutraler Begriff dient so als ideologisches Instrument zum Schutz politischer oder religiöser Autoritäten. Für das muslimische Denken stellt dieses Konzept eines der größten Hindernisse für kritische Reflexion dar.
Der Ausdruck „ulū’l-amr“ („Gehorchet Allah, gehorchet dem Gesandten und denjenigen unter euch, die Befehlsgewalt besitzen“, an-Nisāʾ 4:59) wurde von den klassischen Exegeten unterschiedlich ausgelegt. Aṭ-Ṭabarī versteht ulū’l-amr als sowohl „Herrscher“ als auch „Gelehrte“ (aṭ-Ṭabarī, Ǧāmiʿ al-Bayān). Auch az-Zamaḫšarī nennt beide Auffassungen: Nach manchen sind die „Befehlsgewaltigen“ die politischen Führer, nach anderen die in den religiösen Wissenschaften bewanderten Gelehrten (al-Kaššāf, I, 519). Besonders in der Zeit der Umayyaden und Abbasiden wurde der Ausdruck jedoch auf die politischen Herrscher reduziert, um ihre Legitimität zu stärken und Opposition zu unterdrücken. Der „Gehorsamspflicht“ wurde so eine eindeutig politische Funktion zugewiesen – ein klassisches Beispiel dafür, wie die Bedeutung einer ursprünglich neutralen Wendung durch politische Manipulation verändert wird.
Das Prinzip „amr bi-l-maʿrūf wa nahy ʿani-l-munkar“ („das Gute gebieten und das Schlechte verwehren“, Āl ʿImrān 3:104, 110) bezeichnet im Koran eine Form sozialer Verantwortung. Aṭ-Ṭabarī erklärt diese Wendung als „die Verbreitung dessen, was Gott geboten, und die Unterbindung dessen, was er verboten hat“. Im historischen Verlauf wurde dieses Prinzip jedoch häufig zum Argument für die Unterdrückung von Opposition umgedeutet: Widerspruch gegen die Obrigkeit galt als „munkar“ (verwerflich). (Ibn Taimīya, al-Ḥisba fī-l-Islām). In der Moderne dient es bisweilen als Legitimationsgrundlage für moralische Kontrolle und repressive Maßnahmen.
2) Rückwirkende Einführung moderner Begriffe – wissenschaftlicher Anachronismus
In späteren Jahrhunderten werden Begriffe, die erst in der Neuzeit entstanden (z. B. „Embryo“, „magnetisch“), so interpretiert, als hätten sie bereits im 7. Jahrhundert existiert. Moderne wissenschaftliche Erkenntnisse werden in den Koran hineinprojiziert und semantisch integriert – ein Vorgehen, das als „Bedeutungs-Anachronismus“ bezeichnet werden kann.
Das Wort „nuṭfa“ bedeutete im Arabisch des 7. Jahrhunderts „eine geringe Menge Wasser, ein Tropfen Samenflüssigkeit“. Auch im Lisān al-ʿArab wird nuṭfa als „wenig Wasser“ (qalīl al-māʾ) definiert (Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab). Aṭ-Ṭabarī erklärt den Begriff als „einen Tropfen aus der männlichen Flüssigkeit“. In der Moderne hingegen wird nuṭfa unmittelbar als „Spermium“ übersetzt, und in einigen Exegesen wird sogar behauptet, der Ausdruck verweise auf die DNA (vgl. Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la Science, Paris 1976). Der Anachronismus liegt auf der Hand: Ein biologischer Begriff, der im 7. Jahrhundert unbekannt war, wird nachträglich in den Text hineingelesen.
Das Wort „ʿalaq“ wird in klassischen Wörterbüchern als „das Hängende, das Haftende, ein geronnenes Blutstück“ erklärt (Ibn Fāris, Muʿǧam Maqāyīs al-Luġa). Az-Zamaḫšarī definiert es als „im Mutterleib hängendes Blutgerinnsel“ (al-Kaššāf). In modernen Deutungen wird ʿalaq jedoch mit biologischen Entwicklungsstadien wie „Embryo“ gleichgesetzt (Rašīd Riḍā, Tafsīr al-Manār). Damit wird der Begriff aus seinem ursprünglichen Bedeutungsfeld gelöst und in die moderne Embryologie übertragen. Der wissenschaftliche Begriff Embryo erhielt seine heutige Definition jedoch erst durch Mikroskopie und moderne Biologie zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Die Übersetzung von ʿalaq als „Embryo“ deckt sich somit nicht mit der ursprünglichen Verwendung – sie lädt ein einfaches Wort mit einer Fülle moderner wissenschaftlicher Bedeutungen auf.
Der Begriff „nūr“ („Licht“) erscheint im Koran mit der Bedeutung „Helligkeit, Erleuchtung“ (an-Nūr 24:35). Aṭ-Ṭabarī interpretiert nūr auch metaphorisch als „Gottes Rechtleitung“. In modernen Deutungen wird der Begriff jedoch mit dem elektromagnetischen Spektrum in Verbindung gebracht und mit physikalischen Konzepten wie „Wellenlänge“ und „Photon“ angereichert (vgl. Zaghloul El-Naggar, Scientific Miracles in the Qur’an, 2001). Dies stellt eine semantische Verschiebung vom ursprünglichen Sinn zu modernen naturwissenschaftlichen Vorstellungen dar.
Das Wort „ḏarra“ bedeutet im Koran „das Kleinste, ein Staubkorn“ (Sure az-Zilzāl 99:7–8). Im Lisān al-ʿArab wird es sowohl für eine winzige Ameise als auch für Staubpartikel im Sonnenlicht verwendet. Klassische Exegeten deuten es im übertragenen Sinn als „die geringste gute oder schlechte Tat“ (aṭ-Ṭabarī, Ǧāmiʿ al-Bayān). In der Moderne wird ḏarrahingegen direkt mit dem „Atom“ gleichgesetzt und sogar im Kontext der Kernphysik interpretiert. Damit werden moderne wissenschaftliche Begriffe in den Koran hineingetragen und der ursprüngliche historische Bedeutungsrahmen verlassen.
3) Wörtliche Deutung ursprünglich metaphorischer Begriffe
Begriffe wie „arš“ (Thron) , „weche“ (Angesicht) , „nuzūl“ (Herabkommen) und „yad“ (Hand) besitzen im Koran metaphorische Bedeutungen, werden jedoch in literalistischen Auslegungen als konkrete, physische Realitäten verstanden.
Das Wort „yad“ (Hand) wird im Koran Gott zugeschrieben (Sure al-Fatḥ 48:10; Ṣād 38:75). In klassischen Exegesen wird „Hand“ metaphorisch als „Macht, Fähigkeit, Herrschaft“ gedeutet (ar-Rāzī, Mafātīḥ al-Ġayb). In manchen literalistischen Deutungen hingegen wird der Ausdruck „Hand Gottes“ physisch verstanden und anthropomorph interpretiert. In der Moderne wiederum erhält yad teilweise neue, wissenschaftlich anmutende Bedeutungen wie „Energie“ oder „kosmisches Kraftfeld“. So verbinden sich wörtlich-physikalische und anachronistisch-wissenschaftliche Lesarten im selben Begriff.
4) Bedeutungsverschiebung durch wundersame Aufwertung neutraler Begriffe
Neutralen Begriffen wie „gadbā“ (Gras, Pflanzen), „ḥadīd“ (Eisen) oder „samāwāt“ (Himmel) wird durch übersteigerte Interpretation ein wundersamer, übernatürlicher Wert zugeschrieben.
Das Wort „gadbā“, das im Koran (Sure ʿAbasa 80:28) vorkommt, wird von Ibn ʿAbbās und Elmalılı im Sinne von „weiche Kräuter und Wiesenpflanzen, die Tiere fressen“ erklärt. Einige Interpreten deuten das ursprünglich neutrale Wort jedoch als „Luzerne (Klee)“ und führen anschließend deren durch moderne Forschung nachgewiesene Eigenschaften an, um zu behaupten: „Der Islam hat dies bereits vor Jahrhunderten erkannt.“ Auf diese Weise wird der semantische Kontext des Wortes manipuliert, und wissenschaftliche Erkenntnisse werden zur Stütze dogmatischer Propaganda herangezogen.
Schlussbetrachtung
Die anachronistischen Bedeutungsaufladungen in der Koranauslegung unterscheiden sich somit von natürlichen sprachlichen Bedeutungswandelprozessen, da sie bewusste Eingriffe beinhalten. Diese Eingriffe lösen Begriffe aus ihrem ursprünglichen historischen Kontext und fügen ihnen erst später erworbene Erkenntnisse oder ideologisch geprägte Deutungen hinzu.
Auch wenn solche Deutungen oft aus dem Wunsch entstehen, den Koran im Lichte moderner Wissenschaft zu verteidigen, führen sie hermeneutisch zu gravierenden Anachronismen.
Zudem ist bekannt, dass politische und religiöse Autoritäten stets um die Deutungshoheit religiöser Begriffe rangen. In diesem Kampf wurde der Text oft gezielt instrumentalisiert.
Politische und religiöse Autoritäten rangen und ringen stets um die Deutungshoheit religiöser Begriffe wobei sie Texte und Begriffe gezielt für ihre Interessen instrumentalisierten.
Die Faszination solcher anachronistischen Deutungen mag kurzfristig überzeugen, doch langfristig gefährdet sie sowohl die innere Konsistenz des Textes als auch die sprachliche Kohärenz. Bewusste Bedeutungsverschiebungen – ob ideologisch oder pseudowissenschaftlich motiviert – sind letztlich Formen semantischer Manipulation und entbehren intellektueller Redlichkeit.
Eine rationale und gesunde Koranhermeneutik kann daher nur gelingen, wenn die ursprünglichen historischen Bedeutungsfelder der Begriffe berücksichtigt und ideologische oder wissenschaftliche Anachronismen konsequent vermieden werden.