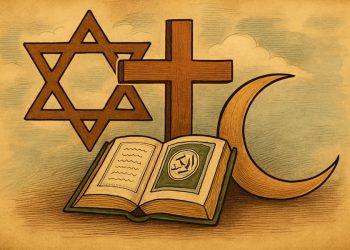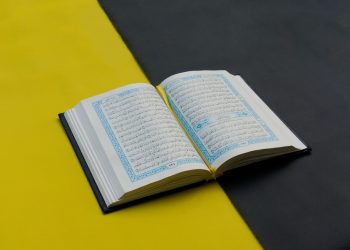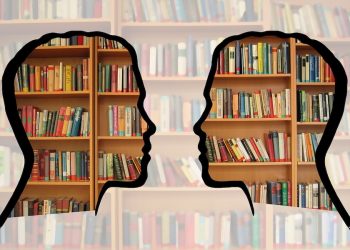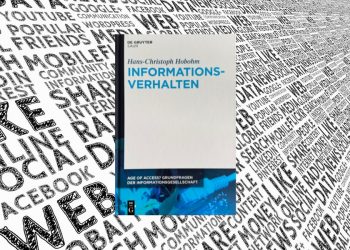Lassen Sie mich es gleich zu Beginn sagen: Zwischen Milch und Milchverkäufer oder Fahrrad und Fahrradmechaniker besteht nur so viel organische Verbindung, wie zwischen dem Volk und einem Populisten. Letztere profitieren von Ersteren und kann sie ausnutzen.
Man kann sagen, dass der Populismus weltweit an Auftrieb gewann, nachdem die Demokratie den Massen institutionell und kulturell nicht das bieten konnte, was sie erwarteten. Man könnte diesen Satz auch so formulieren: „Weil sich manche Länder nicht ausreichend demokratisieren konnten.“ In jüngster Zeit wurde Populismus mit dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA, der dort einen enormen Einfluss ausübte, noch stärker diskutiert.
Populistischer Diskurs
Populistischer Diskurs beruht auf einem Gegensatz. Auf der einen Seite steht das gute und reine Volk, auf der anderen die „bösen Eliten“ und ihre ausländischen Verbündeten, die das Volk ausbeuten, für ihre eigenen Zwecke nutzen und manipulieren.
Populisten sind Meister darin, den Zorn des Volkes mit einem Anti-Korruptions- und Ausbeutungsschema zu steuern. Populistische Führer behaupten, dass sie das Volk gegen degenerierte und „korrupte Eliten“ verteidigen. Doch sie sprechen weder über die Ungleichheit noch über das System, das diese Ungleichheit aufrechterhält, noch über die Rechte und politische Beteiligung des Volkes, das sie zu schützen vorgeben.
Dabei sind Korruption und soziale Ungleichheit miteinander verbundene, sich gegenseitig verstärkende Kreisläufe. Mehr Korruption erzeugt mehr Ungleichheit – das wiederum führt zu Misstrauen und Wut im Volk. Genau diese Wut und dieses Misstrauen machen sich Populisten zu Nutze, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Dennoch ist die Bilanz populistischer Führer bei der Lösung der Probleme von Ungleichheit, Armut und fehlender Freiheit äußerst schwach. Sie nutzen den Diskurs um Korruption und Ungleichheit nur zur Mobilisierung, ohne die Absicht, die Probleme ernsthaft anzugehen.
Die widersprüchliche Realität der Populisten
Obwohl populistische Führer systemkritisch erscheinen, dienen sie nach ihrer Machtergreifung meist dem bestehenden System. Beispiele wie Trump oder Orbán zeigen, dass sie im Gegensatz zu ihren Anti-Korruptionsversprechen Institutionen geschwächt, Transparenz reduziert und die Medien unter Kontrolle gebracht haben.
Trumps Slogan „Den Sumpf trockenlegen“ oder der Aufruf eines anderen populistischen Führers, „die Vormundschaft zu beenden“, fanden in der Öffentlichkeit Gehör und weckten Hoffnung auf den Kampf gegen Autoritarismus und Korruption.
Doch wenn populistische Führer einmal an der Macht sind, erfüllen sie ihre Versprechen selten – stattdessen greifen sie auf Praktiken zurück, die Korruption eher verstärken. In Ländern wie Indien, Italien, der Slowakei, Ungarn und in Trumps Amerika bestehen ernsthafte Zweifel an der Entschlossenheit, Korruption wirklich zu bekämpfen. Auch religiös-moralisch motivierte Parteien und Führer weisen keine reine Weste auf.
Länder wie Polen, Ungarn, Indien und Venezuela verzeichneten einen starken Anstieg im Korruptionswahrnehmungsindex unter populistischen Führern. Dennoch wurden diese trotz unethischen und korruptionsnahen Verhaltens nicht mit ernsthafter institutioneller oder zivilgesellschaftlicher Opposition konfrontiert und konnten an der Macht bleiben. Gleichzeitig wurden in all diesen Ländern Kontrollmechanismen unterdrückt und rechtsstaatliche Prinzipien missachtet.
Daher gilt: Um den Populismus zu bekämpfen, reicht eine politische Haltung allein nicht aus – es braucht strukturelle Reformen:
- Offenlegung des Vermögens von Amtsträgern und ihren Angehörigen vor, während und nach der Amtszeit, öffentlich zugänglich.
- Transparenz bei öffentlich-privaten Übergängen und Kontrolle durch unabhängige Institutionen.
- Stärkung und dauerhafte Unabhängigkeit von Kontrollorganen.
- Förderung der Zivilgesellschaft und unabhängiger Medien sowie Beseitigung von Repressionen gegen sie.
- Keine politische Schutzfunktion für Korruption, keine Vertuschung durch parteiübergreifende Absprachen, keine Straflosigkeit für Schuldige.
- Beendigung der „Drehtürpolitik“ zwischen Wirtschaft und hochrangigen Staatsämtern.
- Keine Flucht hinter politischer Immunität für korrupte Personen – Rechenschaftspflicht wie z. B. bei der „Lava Jato“-Operation in Brasilien.
- Stärkere Kontrolle von Banken, Casinos, Luxusgüterhändlern, Anwälten und Immobilienmaklern, die beim Geldwaschen mitwirken können.
- Verbot von intransparenten, anonymen Unternehmen mit verdeckten Eigentümern.
Fazit
Populismus ist keine Regierungsform, an der das Volk direkt beteiligt ist. Vielmehr ist es eine ideologische Rhetorik derer, die vorgeben, „im Namen des Volkes“ zu regieren. Populisten beuten die berechtigte Wut und Hoffnung des Volkes aus, bieten aber keine Lösungen. Sie definieren die Gesellschaft als harmonisches Ganzes ohne Konflikte – deshalb lehnen sie Pluralismus und Vielfalt ab. Stattdessen propagieren sie ein ideales öffentliches Leben ohne Widersprüche, unter einer zentralen Autorität und Führung.
Doch die soziale Realität sieht anders aus: Gesellschaften bestehen aus Gruppen mit unterschiedlichen Kulturen, Interessen und Lebensauffassungen. Eine stabile Regierung braucht langfristige Lösungen wie die Anerkennung kultureller Vielfalt, Gewaltenteilung, Stärkung demokratischer Institutionen, Förderung sozialer Gleichheit, Partizipation und transparente Regierungsführung.
Kurz gesagt: Populisten gelangen mit einem Anti-Korruptionsdiskurs an die Macht – und machen das korruptive System dauerhaft. Weil Korruption und Ungleichheit sich gegenseitig verstärken, wird Populismus am Ende zu einem Phänomen, das Demokratie schwächt und Autoritarismus unterstützt.
Der Beweis liegt direkt vor unseren Augen.