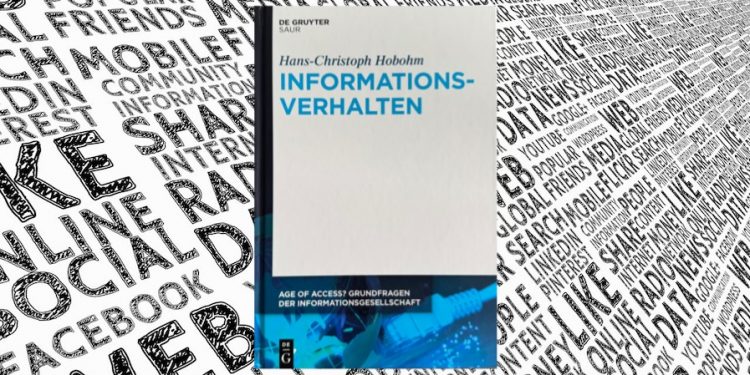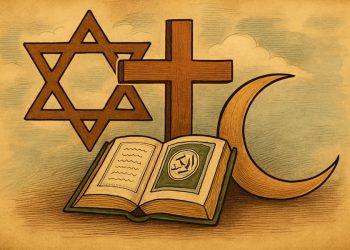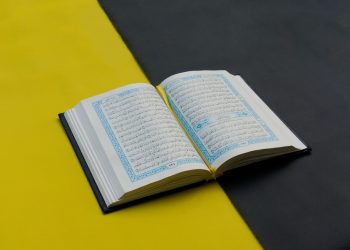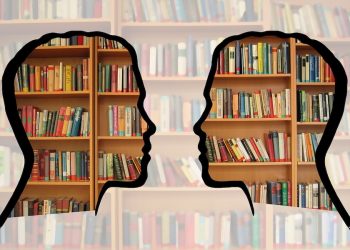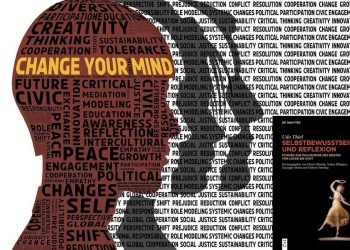Heute gelangen wir in Sekundenbruchteilen an Informationen. Aber was machen wir mit diesen Informationen? Denken wir tatsächlich darüber nach oder scrollen wir nur darüber hinweg? Genau auf diese Fragen richtet der deutsche Informationswissenschaftler Hans-Christoph Hobohm in seinem Buch Informationsverhalten (De Gruyter, 2024) den Fokus. Das Werk zeigt in klarer und eindrucksvoller Weise, wie wir sowohl im akademischen als auch im alltäglichen Leben mit Informationen interagieren.
Die zentrale Frage, die der Autor aufwirft, lautet: „Wie gelangen Menschen an Informationen, wie wählen sie sie aus und wie interpretieren sie sie?“ Bei der Beantwortung dieser Frage werden nicht nur klassische Informationssuchmuster beleuchtet, sondern auch die mentalen und sozialen Beziehungen, die wir zur Information aufbauen. Dies wird in drei Teilen des Buches namens „Information, Verhalten und Informationsverhalten“ eingehend behandelt.
Besonders eindrücklich ist die Feststellung: Informationssuchverhalten ist eine Form des Denkens – was uns interessiert, von wem wir Informationen erhalten und was wir zu glauben bevorzugen, prägt unsere Denkweise. Information ist demnach nicht nur etwas, das wir von außen aufnehmen, sondern auch ein Prozess, der unsere Art zu denken formt. Wonach wir bei Google suchen, wem wir auf Twitter/X folgen oder welche Schlagzeilen wir anklicken (oder eben nicht), beeinflusst mit der Zeit unsere Gedankenstrukturen.
Schmilzt das Denkvermögen in den sozialen Medien dahin?
Besonders zentrale Abschnitte des Buches widmen sich dem Einfluss sozialer Medien und digitaler Plattformen auf das Informationsverhalten. Hobohm zufolge führt der Überfluss an Informationen zu einem „Mangel an Aufmerksamkeit“.
Aufmerksamkeit jedoch ist entscheidend für die Wahrnehmung von Information. Wenn Unaufmerksamkeit oder Veränderungsblindheit unsere selektive Wahrnehmung dominiert – oft verstärkt durch die Medienindustrie – sind vor allem junge Generationen stark von Aufmerksamkeitsstörungen betroffen. So wollen viele Schüler heute weder Bücher lesen noch sich mit Lernen ernsthaft beschäftigen. Wie digitale Geräte in Schulen eingesetzt werden sollten und welche pädagogischen Maßnahmen angesichts wachsender kognitiver und sozialer Störungen notwendig sind, gehört zu den drängendsten Fragen unserer Zeit.
Hobohm bezieht sich auch auf den Psychologen Georg Sammelt, der unterstreicht, dass Aufmerksamkeit existenziell ein soziales Phänomen sei. Sie stehe im Zusammenhang mit der Anerkennung durch andere und dem Selbstwertgefühl. Bleibt die Anerkennung – sei es auch nur in Form kleiner Zeichen von Aufmerksamkeit – aus, entstehen Kränkungen und ein Gefühl der Minderwertigkeit, was für den Menschen negative Folgen hat.
In einer Zeit, in der Nutzer sozialer Medien rasch zwischen Inhalten wechseln, wird Information konsumiert, aber nicht verinnerlicht. Das schwächt das Langzeitgedächtnis. Für nachhaltigen Wissenserwerb braucht es Wiederholung und Tiefe. In den sozialen Medien basiert Information darauf, den Moment zu leben. Aber Lernen erfordert, an die Zukunft zu denken, nicht an den Augenblick.
Hobohms Kritik richtet sich dabei nicht nur gegen das Argument „zu viel Information“. Das eigentliche Problem ist, dass auf digitalen Plattformen, wo Information ständig aktualisiert und ausgetauscht wird, die Zeit, die unser Gehirn dem tiefen Nachdenken widmet, zunehmend schwindet. In diesen Umgebungen stoßen wir oft zufällig auf Informationen statt gezielt zu suchen. Digitale Inhalte werden häufig fragmentiert, kontextlos oder oberflächlich benutzt. „Zufällige Begegnungen“ mit Information erschweren es, diese tief im semantischen Gedächtnis zu verankern. Ohne Integration in einen Kontext oder bewusste Verarbeitung bleibt Information meist nur kurzzeitig im Arbeitsgedächtnis und wird rasch vergessen.
Dies macht es dem Gehirn schwer, neue Informationen mit bestehenden Schemata zu verknüpfen und sie über episodisches Gedächtnis – auf persönlichen Erfahrungen und Ereignissen beruhend – zu speichern. Die Folge der Digitalisierung: Das episodische Gedächtnis wird geschwächt, erfahrungsbasiertes Lernen nimmt ab, Wissen gelangt seltener ins Langzeitgedächtnis und geht im Strom flüchtiger Aufmerksamkeit verloren. Informationen, die nicht wiederholt, geteilt oder in einen sozialen Kontext eingebettet werden, bleiben kaum haften.
Diese kognitiven Veränderungen werden auch durch eine aktuelle wissenschaftliche Studie des MIT Media Lab gestützt, die sich mit den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) befasst – dem vorläufigen Höhepunkt der digitalen Entwicklung. Die Studie zeigt, dass der Einsatz von KI-Werkzeugen tiefgreifende kognitive Prozesse beeinträchtigt, mit potenziell weitreichenden Folgen. Die Forschenden konnten nachweisen, dass etwa die Nutzung von ChatGPT messbare Veränderungen in der Gehirnaktivität bewirkt. Sie sprechen von einer „kognitiven Verzerrung“, die entsteht, wenn Menschen sich zu häufig auf KI verlassen.
Der Umgang mit Information im Zeitalter von Google und TikTok
Hobohm bleibt nicht bei theoretischen Modellen, sondern veranschaulicht seine Thesen auch – wenn auch sparsam – anhand realer Beispiele. So beschreibt er, dass junge Menschen als erste Informationsquelle nicht mehr Bibliotheken nutzen, sondern Google oder TikTok-Videos. Denn Junge Nutzer wenden sich, um ein Thema zu verstehen, zuerst soziale Medien wie YouTube oder TikTok zu – nicht einer Suchmaschine. Das zeigt, dass der Zugang zu Information leichter geworden ist, aber auch, dass der kritische Umgang mit Information schwächer wird, da viele kein Hintergrundwissen haben.
Information zu finden, ist also einfacher denn je, doch ihre Zuverlässigkeit zu hinterfragen oder richtige von falschen Informationen zu unterscheiden, ist erheblich schwieriger geworden. Während eine Zunahme an gesicherten Informationen die Qualität unserer Entscheidungen verbessert, macht der Informationsüberfluss in den sozialen Medien Entscheidungsprozesse oft wirkungslos. Die Herkunft der verarbeiteten Information spielt dabei eine relevante Rolle. So beeinflusst das Vertrauen in die Informationsquelle die Meinungsbildung. Stammt eine Überzeugung z. B. aus einer Religion, einem Glauben oder einer Ideologie, wird ihr oft besondere Bedeutung und Wert beigemessen.
Im weiteren Verlauf des Buches betont Hobohm, dass Informationsverhalten nicht nur ein individuelles, sondern – aus Sicht der sozialen Erkenntnistheorie – auch ein soziales Thema ist. Unser soziales Umfeld spielt eine Schlüsselrolle darin, welchen Informationen wir vertrauen und was wir für wichtig erachten. Ein typisches Beispiel sind die während der Pandemie innerhalb sozialer Gruppen verbreiteten und legitimierten Fehlinformationen.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, über folgende Aussagen des Autors nachzudenken:
„Was für Fische das Wasser ist, das ist für Menschen die Kultur – eine erblich erworbene Umwelt.“
„Information ist eine soziale Realität. Menschen halten oft nicht deshalb an bestimmtem Wissen fest, weil es wahr ist, sondern um ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu demonstrieren.“
Der Autor geht auch u.a. auf den Philosophen Ernst Cassirer ein, der feststellte: „Begriffe sind in der Sprache nicht nur eine abstrakte Spiegelung der Wirklichkeit; sie entstehen durch einen Auswahlprozess aus den Wahrnehmungen der Umwelt.“ So wird Informationsverhalten zu einem Thema, das nicht nur den Einzelnen, sondern auch die intellektuelle Gesundheit einer Gesellschaft betrifft. Denn die im kollektiven Raum entstehenden Informationen, Werte, Normen, Rollen und die Kultur haben unmittelbaren Einfluss auf den Menschen. Das wichtigste ist aber die kognitive Aktivität. Denn „das kognitive Bedürfnis, d. h. der Wunsch, die Welt zu verstehen, ist mit den dazugehörenden kognitiven Kapazitäten wie Wahrnehmung, Intellekt und Lernen für Maslow eine Art Vorbedingung oder „Anpassungswerkzeug“, das zur Befriedigung der anderen Grundbedürfnisse auf allen Ebenen beiträgt. Zu den dafür notwendigen Grundbedingungen zählt er konkret freie Meinungsäußerung, Informationszugang, Gerechtigkeit und Fairness: sind diese eingeschränkt, wirkt sich dies negativ auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse aus.“
Hobohm bietet mit diesem grundlegenden Werk einen starken Ausgangspunkt, um im Informationszeitalter zu hinterfragen, „was“, „warum“ und „wie“ wir lernen. Trotz wissenschaftlicher Tiefe und übermäßiger Fachterminologie ist die Sprache des Buches verständlich und die zahlreichen Beispiele machen es leicht zugänglich. Besonders hervorzuheben ist das breite Begriffsfeld, das das Werk zum Thema Informationsverhalten entwickelt und das als Analysegrundlage dient – mit Begriffen wie Wahrnehmung, Wahrnehmungspsychologie, Verstehen, Kontext, Gedächtnis, Information, Informationswert, Informationsleiter, Informationsgesellschaft, Informationsverarbeitung, Kognition, Aufmerksamkeit, Sprache, Denken, Sorge, Wirklichkeit, Lebenswelt, Kommunikation, Entscheidungsfindung, Wissen, soziale Erkenntnistheorie und Relevanz.
Während Hobohm den tiefen Zusammenhang zwischen Information und Denken aufzeigt, legt er mutig dar, wie diese Verbindung im Zeitalter der sozialen Medien erodiert. Besonders wertvoll sind seine Analysen dazu, wie digitale Plattformen unser Langzeitgedächtnis und unsere Aufmerksamkeitsspanne prägen – ein Beitrag, der hilft, heutige Bildungsprobleme besser zu verstehen und Lösungen zu entwickeln. Das 444 Seiten starke wissenschaftliche Werk, das mitten aus unserer Zeit spricht, wartet mit einem 43-seitigen Literaturverzeichnis auf, das hunderte Quellen umfasst.
Ich empfehle es allen, die im digitalen Zeitalter ihr Verhältnis zur Information hinterfragen möchten – insbesondere Pädagogen, an Medienkompetenz Interessierten und Eltern, die sich Sorgen um die geistigen Auswirkungen sozialer Medien auf ihre Kinder machen.