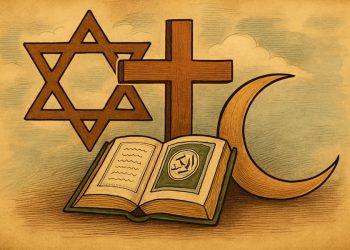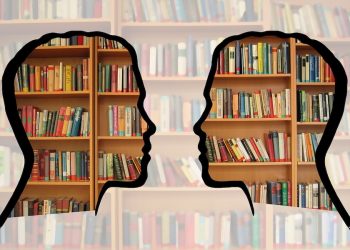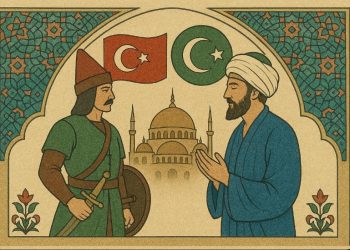Wie kommen Menschen im Alltag zu Wissen? Ein Experte erarbeitet durch Forschung neues Wissen. Darüber hinaus beziehen gewöhnliche Menschen ihr Wissen meist von Experten – oder solchen, die als solche wahrgenommen werden – also von jenen, deren Aufgabe es ist, Wissen zu produzieren und zu vermitteln. In unserer Zeit ist aufgrund der leichten Zugänglichkeit vor allem das Internet zur häufigsten Wissensquelle geworden. Informationen, die – unabhängig von ihrer Quelle – häufig wiederholt, von vielen rezipiert und als wahr dargestellt werden, werden zunehmend als „Wissen“ anerkannt. Auch die sozialen Gruppen, mit denen sich ein Individuum identifiziert, zählen zu den Quellen der Wissensaneignung.
Wie wird in einer Gesellschaft, auch unter Muslimen, religiöses Wissen erlangt? In der Regel nicht durch individuelles Nachdenken, sondern durch Rückgriff auf das Zeugnis anderer, oder? Im islamischen Kontext sind diese „anderen“ überwiegend die Gelehrten und religiösen Autoritäten – also Personen, die als theologische Experten gelten. Religiöses Wissen wird – ähnlich wie in der Medizin oder Gesundheitswissenschaft – meist über äußere Autoritäten vermittelt. Dies ist zugleich ein Gegenstand der sozialen Erkenntnistheorie.
Die soziale Erkenntnistheorie ist ein Zweig der Philosophie, der untersucht, wie Wissen nicht nur durch individuelle Vernunft und Wahrnehmung, sondern durch soziale Beziehungen und gesellschaftliche Strukturen gewonnen wird. Sie beschäftigt sich mit Fragen wie: Von wem nehmen wir Wissen an? Wem vertrauen wir? Welche Autoritäten erkennen wir als legitim an? In diesem Zusammenhang ist „Zeugnis“ – also die Weitergabe von Wissen durch andere – ein zentraler Begriff. Zeugnis bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe von Menschen über Ereignisse berichtet, die sie selbst erlebt oder beobachtet hat. In diesem Sinne ist es ein wichtiger Weg indirekter Wissensaneignung. Die Zuverlässigkeit dieses Wissens hängt jedoch davon ab, ob der Zeuge die Wahrheit sagt, welche Absicht er hat und wie sachkundig er ist.
Beim religiösen Wissen darf Zeugnis nicht nur mit Auslegung oder Interpretation gleichgesetzt werden; denn auch der Koran selbst beruht in gewisser Hinsicht auf dem Zeugnis des Propheten. Die Offenbarung, das Fundament des Islams, wurde der Gesellschaft durch sein Zeugnis übermittelt. Dieses geheimnisvolle Zeugnis, das über einen Zeitraum von 22 Jahren dauerte, ist die Grundlage der Fremdbestimmung. In der Wissenshierarchie stellen besonders die Traditionalisten die Offenbarung an die Spitze. Daraus leiten sie ab, dass die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gebote des Korans nicht aufgehoben werden können und dass sich Gesellschaft, öffentlicher Raum und Wirtschaft diesen Geboten unterzuordnen haben. Doch da ihnen der ethische Mut fehlt, dies offen auszusprechen, versuchen sie ihre islamistischen oder salafistischen Ideen „durch die Hintertür“ über Begriffe wie Hermeneutik, Historisierung oder Orientalismus durchzusetzen. Leider stellen sie ihre eigenen Auslegungen in den Vordergrund, indem sie das heilige Zeugnis ausschließlich und unhinterfragt als letzte Referenz erheben – gegenüber wissenschaftlicher Erkenntnis, den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats und universellen ethischen Normen. Auf diese Weise tragen sie implizit zur Legitimierung einer theokratischen Ordnung bei.
Das eigentliche Problem liegt darin, dass durch eine göttlich begründete, somit vermeintlich unangreifbare Zeugenschaft die epistemische Gültigkeit von Wissen jeglicher Diskussion entzogen wird. Die Akzeptanz solchen Wissens wird somit zu einem zwanghaften, automatischen Vorgang. Nach klassischer islamischer Theologie sind der Koran und die Hadithe die Hauptreferenzen für epistemisches Vertrauen; diese Texte gelten in Bezug auf Wahrheit und Gültigkeit weitgehend als unantastbar. Doch das daraus erzeugte Wissen ist durchaus diskutierbar und widerlegbar. Manche Traditionalisten aber, die sich selbst als Wächter oder Sprachrohr Gottes verstehen, möchten ihre Deutungshoheit nicht verlieren und greifen daher auf Diskreditierungsstrategien zurück wie Takfir (jemanden des Unglaubens beschuldigen), Vorwürfe des Glaubensabfalls oder mangelnden Glaubens. Mit listiger Berechnung und beinahe gieriger Leidenschaft treiben sie die sakrale Zeugenschaft so weit, dass man entweder gezwungen wird, wie sie zu denken oder sich als Gegner positionieren muss.
Wer mit neuen, von der klassischen islamischen Lehre abweichenden Deutungen zu Themen wie „die Natur der Offenbarung“, „Kontextualisierung religiöser Texte“, „Offenbarungsanlässe“, „abrogierte und abrogierende Verse“,“mekkanische und medinensische Verse“, „Ziele und Nutzen (maqāṣid)“, „Reform im Islam“ oder „das Wesen der Wunder“, „die Wahrheit der Erzählungen im Koran“ auftritt, wird sofort dämonisiert. Es wird eine Art religiöses Mobbing betrieben: „He, das ist unser Revier! Wer bist du, dass du religiöses Wissen produzieren willst?“ Doch daraus sollte nicht geschlossen werden, dass Expertise in einem Fachgebiet nicht wertgeschätzt wird. Theologie ist selbstverständlich auch ein wissenschaftliches Fach.
Zahlreiche muslimische Philosophen und Theologen sind sich darin einig, dass ein rein inneres oder autoritätsbasiertes Zeugnis nicht automatisch zur gesicherten Erkenntnis führt. Bemerkenswert ist ein Satz von al-Farabi: „Wenn das, worüber ein Mensch ein Urteil fällt, in der äußeren Welt genau so existiert, wie es im Verstand geglaubt wird, dann ist es gesichertes Wissen.“ (al-Farabi, Kitāb al-Jadal, S. 28) Mit anderen Worten: Es braucht nicht nur innere Überzeugung, sondern auch Übereinstimmung mit der äußeren Realität. Wissen, das auf innerem Zeugnis beruht, kann durch empirische oder wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt werden; dies gilt auch für philosophisches oder wissenschaftliches Wissen.
Doch sobald menschlich erzeugtes Wissen auf Offenbarung gestützt wird, verändert sich die Lage. Die religiösen Referenzquellen werden meist nicht kritisiert; sie gelten als sakrosankt. Eine solche Struktur von sakralisiertem Zeugnis wird in gewisser Weise zum absoluten Wahrheitsanspruch. Der Widerstand gegen historisch-hermeneutische Interpretationen hat seinen Ursprung in dem Glauben, dass aus Offenbarung abgeleitetes Wissen stets universell gültig sei und – fälschlicherweise – alle Probleme der Menschheit lösen könne. Dieses Verständnis strebt danach, eine Gedankendiktatur in sämtlichen Bereichen – Kosmos, Mensch, Gesellschaft und Religion – zu errichten, in der alle Interpretationsräume monopolisiert werden. Doch nur wenn Wissen offen für Kritik und Begründung ist, kann es sich weiterentwickeln; andernfalls verkommt es zur Dogmatik.
Was ist also das wichtigste Element, das Wissen zur Gewissheit führen kann? Natürlich: die Vernunft. Aber welche Vernunft? Diejenige, die – wie Kant – universelle Gesetze sucht? Oder eine, die lediglich den eigenen Glauben oder die eigene Ideologie rationalisiert und bewacht? Ohne Zweifel ist das eine der zentralen ontologischen und erkenntnistheoretischen Herausforderungen religiösen Denkens, die durch eine kritische Selbstreflexion von innen heraus bewältigt werden muss.
Der zentrale Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass die um sakralisierte Zeugenschaft geformte Wissenshierarchie strukturelle Risiken birgt, die die kognitive Autonomie des Individuums schwächen und zu Denkverengung führen können. Diese lassen sich in mehreren Aspekten zusammenfassen:
Unterdrückung kritischen Denkens
Das Hauptproblem besteht darin, dass Menschen nicht die Fähigkeiten entwickeln, Wissen zu hinterfragen, sondern Aussagen heiliger Texte, religiöser Autoritäten oder offizieller Institutionen als absolut wahr akzeptieren. Diese Haltung schwächt die epistemische Autonomie des Subjekts und verwandelt Wissen in ein Objekt passiver Übernahme, statt aktiver Forschung.
Ein junger Mensch hört z. B. auf Social Media einen beliebten Prediger sagen: „Wenn du dieses Gebet nicht so verrichtest, ist es ungültig.“ Ohne die primären Quellen zu prüfen oder sich mit den verschiedenen Rechtsschulen auseinanderzusetzen, übernimmt er diese Sichtweise, vielleicht obwohl er es bisher anders gelernt hatte. Mit dem Gedanken „Der Hodscha ist sehr gebildet, er hat tausende Follower“ setzt er sein eigenes kritisches Denken außer Kraft und unterdrückt damit seine eigene epistemische Kompetenz.
In traditionellen muslimischen Gesellschaften ist ein wohlwollendes Vertrauen und eine Unterwerfung gegenüber Autoritäten sowie gegenüber dem von früheren Generationen überlieferten Wissen weit verbreitet – seien es religiöse Gelehrte, Wissenschaftler oder als Meinungsführer anerkannte Persönlichkeiten. Dies verhindert die Herausbildung einer „intellektuellen Wachsamkeit“ beim Individuum. Infolgedessen können sich weder kritisches Denken noch eine Kultur des Widerstands oder Widerspruchs in der Gesellschaft entwickeln.
Leben mit dem Verstand anderer (epistemische Heteronomie)
Die Kultur des sakralisierten Zeugnisses verdrängt das eigenständige Denken des Menschen. Stattdessen beginnt das Individuum ständig zu fragen: „Was sagt dieser Gelehrte dazu? Was gilt laut dieser Rechtsschule oder dieser Gruppe?“ Das schwächt die Fähigkeit zur eigenständigen Urteilsbildung, also die epistemische Autonomie.
In einer solchen Kultur, in der Wissen auf sakralem Zeugnis basiert, wird sogar im Alltag vermehrt nach religiösen Rechtsurteilen (Fatwas) gesucht:
- „Darf man beim Fasten Miswak (Zahnpflegeholz) benutzen oder schwimmen gehen?“
- „Müssen Frauen beim Sport das Kopftuch tragen?“
- „Ist Musik haram?“
- „Widerspricht Impfen dem Islam?“
- „Ist die E-Zigarette erlaubt?“
Solche Fragen zu stellen, ist an sich kein Problem. Doch wenn diese Gewohnheit chronisch wird, schwächt sie die Fähigkeit zum autonomen Denken. So können sich kritische Denkfähigkeiten nicht entwickeln und der Zugang zu verlässlichem Wissen bleibt beschränkt.
Eine epistemisch selbstbestimmende Person akzeptiert nicht einfach alles, was ihr präsentiert oder vermittelt wird, sondern stellt folgende Fragen:
Ist diese Information logisch? Gibt es Belege? Wird sie im Koran oder in klassischen Quellen fundiert? Und vor allem: Hat sie heute noch Relevanz?
Andernfalls erleben wir Phänomene wie dieses: Das Wort gadbā im Koran (Sure 80:28), das z. B. von bekannten Koranxegeten wie Ibn Abbas und Elmalılı als „weiche Pflanzen und Gräser, die Tiere fressen“ gedeutet wurde, wird plötzlich als „Luzerne“ interpretiert. Danach werden moderne wissenschaftliche Erkenntnisse über Luzerne auf diesen Vers projiziert und behauptet: „Der Islam hat das alles schon vor Jahrhunderten erkannt!“ Dadurch wird der Kontext des Wortes verfälscht, und wissenschaftliche Neugier verkommt zur dogmatischen Propaganda.
Wissenshierarchie und Kultur des Schweigens
Ein grundlegendes Problem konservativer Kreise ist die epistemische Ungleichheit. Diese zeigt sich darin, dass einige Menschen als Wissensproduzenten oder glaubwürdige Quellen gelten, während andere systematisch ausgeschlossen oder ignoriert werden. Es gibt Zeiten, in denen viele Wissende schweigen, nicht weil sie nichts zu sagen hätten, sondern weil sie in hierarchischen Strukturen ohne Autorität keine Stimme haben.
Selbst auf akademischer Ebene ziehen es viele trotz Fachwissen vor, zu schweigen. Manchmal geschieht dies aus Angst vor offenem Druck, manchmal aus Rücksichtnahme auf implizite Abhängigkeitsverhältnisse. Wenn z. B. ein Theologe das Thema Kinderehen, wie es in manchen Hadithen vorkommt, zur Sprache bringt – ein Thema, das heute gesellschaftlich nicht mehr vermittelbar ist -, wird er entweder hart angegriffen, ignoriert oder zum Schweigen gebracht, weil die Debatte heilige Texte berührt.
Epistemische Gleichheit ist nur möglich, wenn wir den Mut haben, über die „Sakralität“ hinauszudenken. Ansonsten wird Wissen zu einer gefährlichen Machtbeziehung, die von wenigen kontrolliert und von vielen nicht hinterfragt wird.
Wissen im Schatten des Dogmas
Wichtig ist: Ziel dieses Textes ist es nicht, das Heilige an sich infrage zu stellen. Aber das mit dem Heiligen assoziierte Wissen darf nicht zur unantastbaren Dogmatik werden – weder epistemologisch noch gesellschaftlich.
Denn wenn jede Information durch eine sakralisierte Autorität vermittelt wird, wird Kritik schnell zum Tabu. Fragen stellen, Zweifel äußern oder alternative Denkansätze entwickeln gelten dann als Zeichen von „Glaubensschwäche“. So verschwimmt die Grenze zwischen Wissen und Dogma.
Es kommt vor, dass eine Interpretation eines Rechtsschul-Gründers wie ein Koranvers behandelt wird. Widerspruch gegen diese Sichtweise wird sofort als „Abweichung“ gebrandmarkt. Dies schränkt den Zugang zu anderen Quellen, die Fähigkeit zur kritischen Analyse und die epistemische Vielfalt massiv ein.
Eine der Nebenwirkungen sakralisierten Zeugnisses ist: Wissen stagniert, wird verformt, entwickelt sich nicht weiter. Es dient nur dazu, vorgeformte dogmatische Gedankeninhalte zu füllen.
Sakralisiertes Zeugnis braucht ethisch-wissenschaftliche Begegnung
Menschliches Verhalten wird nicht nur durch Glaubenssätze bestimmt; auch soziale Bedingungen, materielle Bedürfnisse und psychologische Faktoren spielen eine Rolle. Werte verändern sich je nach körperlichen, materiellen oder psychosozialen Bedürfnissen.
So ist es für viele Muslime selbstverständlich, sich durch Kopftuch oder Verzicht auf Schweinefleisch religiös zu positionieren, um ihre religiöse Identität zu präsentieren. Gleichzeitig wird aber das klar formulierte Gebot im Koran „Verleumdet einander nicht!“ (49:12) oft bedenkenlos übertreten. Solche Widersprüche zeigen, welche Form von Zeugenschaft überwiegt: Sichtbare, äußere Rituale verdrängen ethisch-performative Dimensionen wie Charakterbildung oder moralische Konsistenz.
Solche Widersprüche zeigen, welche Form epistemischer Zeugenschaft im Prozess der Verinnerlichung religiöser Werte dominierend ist. Eine heilige Zeugenschaft, die sich auf sichtbare und äußerliche Rituale stützt, stellt häufig normative Aspekte in den Vordergrund, während performative Dimensionen wie ethische Werte, Charakterbildung und moralische Kohärenz in den Hintergrund gedrängt werden. Dies führt zu einer epistemischen Verengung und moralischen Dissonanz in religiösen Praktiken. Die Überwindung moralischer Brüche kann daher nur gelingen, wenn das epistemische Regime der sakralisierten Zeugenschaft durch wissenschaftliche Methodologie, kritisches Denken und ethische Reflexion ergänzt wird. Auf diese Weise lässt sich über verschiedene Formen von Zeugenschaft ein breiterer und inklusiverer Zugang zu Wissen eröffnen.
In der Kindererziehung etwa sollten neben äußeren Regeln auch geistige und moralische Prozesse berücksichtigt werden. Religionsunterricht sollte nicht nur vermitteln, was haram oder halal ist, sondern auch, warum etwas so ist und wie man zu einem besseren Menschen wird.
Leider bleiben die Antworten in einer sich immens wandelnden Welt oft gleich. Auf neue sozio-kulturelle Fragen folgen immer noch Antworten aus klassischen Religionsbüchern. Ob digitale Privatsphäre, Künstliche Intelligenz oder Umweltkrise – alte Kontexte werden auf neue Probleme übertragen, was die Wissensproduktion blockiert.
Das führt zur Erstarrung von Wissen und zu Kontextverlust. Kann ein Jugendlicher, der auf Social Media nach Antworten zur digitalen Intimsphäre fragt, wirklich profitieren, wenn man ihm mittelalterliche Äußerungen aus dem Katechismus präsentiert?
Wenn Vernunft erstickt, erstarrt Überlieferung
Religiöses Wissen basiert ihrer Natur nach wesentlich auf sozialer Erkenntnistheorie, weil religiöse Texte meist durch Interpretation verständlich werden. Doch wenn dieser Interpretationsprozess den Verstand und den Willen des Einzelnen ausschaltet, entsteht nicht Wissen, sondern Gehorsam. Mit meiner These „Die Vernunft soll die Überlieferung tragen, aber nicht unter ihr zusammenbrechen“ wollte ich genau das sagen.
Das Verhältnis zwischen Vernunft und Überlieferung ist im islamischen Denken nicht nur ein intellektuelles, sondern auch ein Freiheitsproblem. Ohne folgende Frage zu stellen, lässt sich das nicht lösen: Kann ein Mensch wirklich frei sein, wenn er sich unter dem Druck vormoderner Gelehrter, die sich auf Koran und Hadith stützen, seines Verstandes berauben lässt?
Wenn der Verstand unter sakralisiertem Zeugnis begraben wird, entsteht ein mentaler Zustand des reinen Auswendiglernens, des Nicht-Hinterfragens. Viele Muslime zeigen heute einen Reflex, der bei Aussagen religiöser Autoritäten sofort die Vernunft abschaltet: „Wenn es im Koran steht, ist die Sache erledigt“, „Wenn es sich um einen Hadith handelt, wird nicht diskutiert“, „Wenn ein Mudschtahid (islamischer Rechtsgelehrter) das gesagt hat, ist alles klar.“ Diese Denkweise betrachtet den Verstand als passiven Wächter – was für eine krankhafte Einstellung. Die eigentliche Kritik richtet sich nicht gegen die Quellen, sondern gegen jene Denkweise, die aus interpretierter Überlieferung ein unveränderbares Dogma macht.
Die Verstummung der Vernunft im Schatten der Tradition
Dass eine so einflussreiche Persönlichkeit wie al-Ghazali Philosophen wie Ibn Sina (Avicenna) und al-Farabi der Ketzerei bezichtigte und die Theologie über die Philosophie stellte (Tahāfut al-Falāsifa – „Der Widerspruch der Philosophen“), markiert einen Wendepunkt in der islamischen Geistesgeschichte. Durch diesen Bruch konnte sich die traditionelle Auslegung dauerhaft durchsetzen. Das Vertrauen in Vernunft und philosophisches Denken wurde erschüttert, das Tor zum Idschtihad (eigene Rechtsfindung) weitgehend geschlossen. Religiöses Wissen wurde im Zentrum durch die Gelehrtenklasse monopolisiert, während individuelle und kritische Denkansätze zunehmend als Fitna (Zwietracht, Unheil) angesehen wurden.*
Der Einfluss dieser Entwicklung reicht bis in die Gegenwart. Wo die Vernunft unterdrückt wird, verliert das Denken seine Lebendigkeit – Interpretation bleibt ein endloses Wiederkäuen der Vergangenheit. Freidenkende Individuen werden ersetzt durch Wiederholer und Überlieferer. Dies ist nicht nur ein intellektuelles Problem, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung: Es entstehen passive, autoritätsabhängige und leicht manipulierbare Menschen.
Kann man mit der traditionellen Rechtsmethodik – etwa durch Qiyas (Analogieschluss), Maslaha (gemeinwohlorientiertes Urteil) oder Istihsan (juristische Präferenz, das Für-Besser-Halten) – komplexe moderne Fragen zur digitalen Privatsphäre, künstlichen Intelligenz oder zur Umweltethik lösen? Diese methodischen Instrumente existieren zweifellos, doch ihre Wirksamkeit hängt davon ab, ob kritisches und eigenständiges Denken überhaupt erlaubt ist. Wird die Vernunft unterdrückt, verlieren auch diese Instrumente ihre Funktion – und die Folge ist eine epistemische Stagnation, in der nur die Vergangenheit wiederholt wird.
Die gegenwärtige Wissenskrise in muslimischen Gesellschaften vertieft sich dadurch, dass religiöses Wissen fast ausschließlich im Rahmen sakralisierter Zeugenschaft vermittelt wird. Diese Vermittlungsform verleiht vor allem Theologen und Meinungsführern eine strategische epistemische Autorität – ein Monopol auf Deutung. Dadurch verhärtet sich die Wissenshierarchie, und alternative Denkansätze und Interpretationen werden unterdrückt.
Die gesetzliche Regelung, die das Amt für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) in der Türkei die Befugnis zur Kontrolle von Koranübersetzungen (meâl) überträgt, kann als Beispiel für die Institutionalisierung epistemischer Machtverhältnisse zwischen Staat und religiösen Institutionen gewertet werden. Auf diese Weise stellt die Monopolisierung religiösen Wissens im Kontext epistemischer Ungerechtigkeit und Wissenspolitik ein wesentliches Hindernis für die gesellschaftliche Wissensproduktion und Pluralität dar.
Am Ende lässt sich die zentrale Frage so formulieren: Besteht religiöses Leben nur darin, überliefertes Wissen zu wiederholen? Oder entwickelt es sich dadurch gesund, dass man dieses Wissen versteht, an zeitgenössische Bedingungen anpasst, mit einem Bewusstsein für moralische Verantwortung verinnerlicht und in ethisches Handeln umsetzt?
*Anmerkung zum historischen Kontext
In der frühen islamischen Epoche war einerseits das Studium antiker griechischer Philosophie weit verbreitet und philosophischer Einfluss sichtbar; andererseits mehrten sich auch vielfältige religiöse Deutungen. Diese beiden Entwicklungen riefen konservative Reaktionen hervor, die eine fundamentale, ursprüngliche Interpretation von Koran und Hadith anstrebten. Am bekanntesten ist al-Ghazali in dieser Hinsicht.
Doch später verhinderten verschiedene Faktoren die Entstehung produktiven und dynamischen Wissens: Die islamische Welt wurde durch mongolische Invasionen und endlose Kreuzzüge erschüttert, woraufhin sich eine defensive, sicherheitsorientierte und konservative Denkweise durchsetzte – und zur dauerhaften Tradition wurde. Auch der Verlust akademischer Unabhängigkeit (etwa durch die Transformation zur ulema-i rüsum, einer von Staat und Macht gesteuerten Gelehrtenkaste) war zweifellos ein bedeutender Faktor.
Ob dieser Rückzug letztlich dem Ziel diente, inmitten starker äußerer Bedrohungen „innere Zwietracht“ zu vermeiden, bleibt offen. Doch sicher ist: Dass sich diese Reaktion nach einer langen Phase der Lähmung verfestigte, hat maßgeblich zur heutigen prekären Situation vieler muslimischer Gemeinschaften beigetragen.
Auf Türkisch: https://mmertek.de/bilgi-hiyerarsisinde-kutsallastirilan-taniklik-uezerine-bir-deneme/