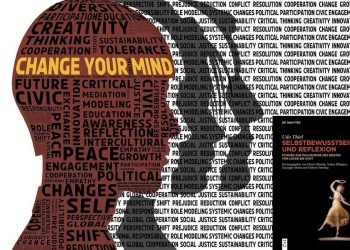Junaid Hafeez, ein pakistanischer Akademiker, wurde nach seiner sechsjährigen Haft im Dezember 2019 wegen der Beleidigung des Propheten Muhammad auf Facebook zum Tode verurteilt. Laut der US-amerikanischen Kommission für internationale Religionsfreiheit hat Pakistan nach dem Iran die zweitstrengsten Blasphemiegesetze der Welt.
Hafeez, gegen dessen Todesurteil Berufung eingelegt wird, ist einer von rund 1.500 Pakistanern, die in den letzten drei Jahrzehnten wegen Islamlästerung oder Sakrilegien angeklagt wurden. Bis jetzt wurde er nicht hingerichtet.
Aber seit 1990 wurden 70 Menschen auf Grund solcher Anschuldigungen gelyncht. Mehrere Personen, die den Angeklagten verteidigten, wurden ebenfalls getötet, darunter einer von Hafeez Anwälten und zwei hochrangige Politiker, die sich öffentlich gegen das Todesurteil für die Christin Asia Bibi aussprachen, die wegen verbaler Beleidigung des Propheten Muhammad verurteilt worden war. Obwohl Bibi 2019 freigesprochen wurde, floh sie aus Pakistan.
Straftaten Blasphemie und Abfall vom Glauben
Von den 71 Ländern, die Blasphemie unter Strafe stellen, sind 32 Länder mehrheitlich muslimisch geprägt. Die verhängten Sanktionen sind jeweils unterschiedlich.
Blasphemie wird im Iran, in Pakistan, Afghanistan, Brunei, Mauretanien und Saudi-Arabien mit dem Tod bestraft. In nicht-muslimischen Ländern sind die Strafen sehr geringfügig, als strengste Strafe wird in Italien eine dreijährige Gefängnisstrafe angedroht.
Die Hälfte der 49 muslimischen Länder auf der Welt hat zusätzliche Gesetze, die den Abfall vom Glauben verbieten und Menschen, die den islamischen Glauben aufgeben, mit der Todesstrafe bedrohen. Alle Länder mit Apostasiegesetzen sind – mit Ausnahme Indiens – muslimische Länder. Abfall vom Glauben wird oft zusammen mit Gotteslästerung angeklagt.
Diese Art von religiös geprägten Strafen findet in einigen muslimischen Ländern große Unterstützung in der Gesellschaft. Laut einer Pew-Umfrage aus dem Jahr 2013 befürworten etwa 75% der Befragten in Südostasien, im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Südasien die Scharia oder das islamische Recht zum offiziellen Gesetz des Landes zu machen.
Unter denjenigen, die die Scharia unterstützen, sagen rund 25% in Südostasien, 50% im Nahen Osten und in Nordafrika und 75% in Südasien, dass sie die „Hinrichtung derer unterstützen, die den Islam aufgeben“ – das heißt, sie unterstützen Gesetze, die den Abfall vom Glauben mit dem Tod bestrafen.
Bündnis zwischen muslimischen Gelehrten und Staat
Mein Buch „Islam, Autoritarismus und Unterentwicklung“ aus dem Jahr 2019 führt die Wurzeln der Blasphemie- und Apostasiegesetze in der muslimischen Welt auf ein historisches Bündnis zwischen islamischen Gelehrten und Regierungen zurück.
Ab dem Jahr 1050 begannen einige sunnitische Rechts- und Theologiegelehrten, die als „Ulema“ bezeichnet wurden, eng mit politischen Herrschern zusammenzuarbeiten, um den ihrer Meinung nach sakrilegischen Einfluss muslimischer Philosophen auf die Gesellschaft in Frage zu stellen.
Muslimische Philosophen leisteten in drei Jahrhunderten vom 9. bis zum 11. Jahrhundert wichtige Beiträge zu Mathematik, Physik und Medizin. Sie entwickelten das heute im Westen verwendete arabische Zahlensystem und erfanden einen Vorläufer der modernen Kamera, die dunkle Kammer.
Die konservativen Ulema war der Ansicht, dass diese Philosophen unangemessen von der griechischen Philosophie und dem schiitischen Islam zu Ungunsten des sunnitischen Glaubens beeinflusst wurden. Der prominenteste Verfechter einer Festigung der sunnitischen Orthodoxie war der brillante und angesehene Islamgelehrte Ghazali, der im Jahr 1111 starb.
In mehreren einflussreichen Büchern, die heute noch viel gelesen werden, erklärte Ghazali zwei führende muslimische Philosophen, Farabi und Ibn Sina, zu Abtrünnigen – u.a für ihre unorthodoxen Ansichten über die Ewigkeit des Universums, die Einschränkung des göttlichen Allwissens und die nichtphysische Natur der Auferstehung. Sie und ihre Anhänger, schrieb Ghazali, könnten mit dem Tod bestraft werden.
Nach Auffassung der Historiker Omid Safi und Frank Griffel legitimierte Ghazalis religiöses Urteil muslimische Sultane ab dem 12. Jahrhundert, die Denker verfolgen oder sogar hinrichten wollten, die als Bedrohung für die konservative religiöse Herrschaft angesehen wurden.
Dieses „Ulema-Staat-Bündnis“, wie ich es nenne, begann Mitte des 11. Jahrhunderts in Zentralasien, im Iran und im Irak und breitete sich ein Jahrhundert später in Syrien, Ägypten und Nordafrika aus. In diesen Regimen war die Infragestellung der religiösen Orthodoxie und der politischen Autorität nicht nur ein Widerstand, sondern ein Abfall vom Glauben und Islamlästerung. Durch solche Anschuldigungen konnten sie ihre Autorität jahrhundertelang behaupten.
Falsche Richtung
Teile Westeuropas wurden von einem ähnlichen Bündnis zwischen der katholischen Kirche und den Monarchen regiert. Diese Regierungen griffen auch das freie Denken an. Während der spanischen Inquisition zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert wurden Tausende von Menschen wegen Apostasie gefoltert und getötet.
Bis vor kurzem gab es in verschiedenen europäischen Ländern auch Blasphemiegesetze, obwohl diese nur selten angewendet wurden. Dänemark, Irland und Malta haben kürzlich ihre Gesetze aufgehoben.
Aber sie bestehen in vielen Teilen der muslimischen Welt fort. In Pakistan ist der Militärdiktator Ziya ul Haq, der das Land von 1978 bis 1988 regierte, für die strengen Blasphemiegesetze verantwortlich. Als Verbündeter der Ulema aktualisierte Ziya die Blasphemiegesetze, die von britischen Kolonialherren verfasst wurden, um interreligiöse Konflikte zu vermeiden. Er veränderte sie, um den spezifisch sunnitischen Islam zu verteidigen, und fügte die Todesstrafe hinzu.
Seit den 1920er Jahren bis zur Herrschaft Ziyas wurden diese Gesetze nur etwa ein Dutzend Mal angewendet. Seitdem sind sie ein mächtiges Werkzeug geworden, um Dissens zu unterdrücken.
Etwa ein Dutzend muslimische Länder, darunter der Iran und Ägypten, haben in den letzten vier Jahrzehnten einen ähnlichen Prozess durchlaufen.
Gegenstimmen im Islam
Die konservativen Ulema stützt ihre Argumente für Blasphemie- und Apostasiegesetze auf einige Berichte des Propheten Muhammad, bekannt als Hadithe, vor allem auf die Aussage: „Wer seine Religion ändert, tötet ihn.“
Aber viele islamische Gelehrte und muslimische Intellektuelle lehnen diese Ansicht als radikal ab. Sie argumentieren, dass der Prophet Muhammad niemals jemanden wegen Abfalls hingerichtet oder seine Anhänger dazu ermutigt hat.
Die Tötung von Apostaten basiert auch nicht auf dem heiligen Haupttext des Islams, dem Koran. Er enthält über 100 Verse, die Frieden, Geduld, Toleranz und Gewissensfreiheit fördern. In Sure 2, Vers 256, heißt es im Koran: „In der Religion gibt es keinen Zwang.“ In einem anderen Koranvers (4:140) fordert er die Muslime auf, einfach Gespräche mit Leugnern anzubrechen: „Wenn ihr hört, dass die Zeichen (Verse) Gottes geleugnet werden und dass über sie gespottet wird, sollt ihr nicht länger mit ihnen sitzen.“
Durch die Nutzung ihrer politischen Verbindungen und ihrer Autorität zur Interpretation des Islams haben die konservativen Religionsgelehrten (Ulema) jedoch gemäßigtere Stimmen an den Rand gedrängt.
Wirkungen auf globale Islamophobie
Die Debatten über Blasphemie und Apostasie unter Muslimen werden von globalen Umständen beeinflusst. Überall auf der Welt werden muslimische Minderheiten – darunter Palästinenser, Tschetschenen in Russland, Kaschmiris unter indischer Herrschaft, Rohingya in Mymanmar und Uiguren in China – verfolgt und unterdrückt.
Neben diesen Verfolgungen gibt es einige westliche politische Maßnahmen, die Muslime diskriminieren, wie Gesetze, die Kopftücher in Schulen verbieten, und das US-Visumverbot von Reisenden aus mehreren Ländern mit muslimischer Mehrheit.
Solche islamophobische Politik kann den Eindruck erwecken, dass Muslime belagert würden, und ein Argument dafür liefern, dass die Bestrafung von Apostaten eine Verteidigung des Glaubens darstelle.
Stattdessen finde ich, dass solch strenge religiöse Regeln zur Verstärkung anti-muslimischer Vorurteile beitragen können. Einige meiner türkischen Bekannten raten sogar von meiner Arbeit zu diesem Thema ab, weil sie befürchten, dass dies die Islamophobie anheizt.
Meine Forschung zeigt jedoch, dass die Bestrafung von Blasphemie und Abfall vom Glauben eher politisch als religiös motiviert ist. Der Koran verlangt keine Bestrafung von Apostasie, autoritäre Politik schon.
(Übersetzt von MMertek)
Der Artikel wurde auf Englisch, Französisch und Indonezisch in The Conversation veröffentlicht.
https://theconversation.com/execution-for-a-facebook-post-why-blasphemy-is-a-capital-offense-in-some-muslim-countries-129685
Als Arbeitsblatt:
In diesem Arbeitsblatt wird der Text Ahmet Kurus zur Blasphemie aufgabengeleitet bearbeitet. Es eignet sich für die Jahrgänge 10/11.
Ein Lösungsblatt ist angefügt.
Hier klicken: Warum Blasphemie mit dem Tod bestraft wird_AB mit Lösung_Jg.10-EF